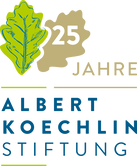Forschungsplan
In den 70er Jahren hat die Intensivierung der Tierproduktion einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Tierwohlforschung hingegen stand noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Vor diesem Hintergrund kam die Frage auf, inwiefern die intensivierte Domestikation und die restriktiven Haltungssysteme das Verhalten der Nutztiere verändert haben. Gibt es Verhaltensweisen, die genetisch konserviert sind und sich auch nach vielen Generationen intensiver Selektion nicht verändert haben? Oder hatte die Zucht zur Folge, dass sich das Verhalten der Tiere angepasst hat?
Eine Forschungsgruppe um Alex Stolba und David Wood-Gush wollte damals untersuchen, ob Sauen aus Kastenstandhaltung und mit der üblichen Genetik noch in der Lage sind, in einer semi-natürlichen Umgebung zu überleben. Dafür konzipierten sie 1978 einen Versuch in der Nähe von Edinburgh, wo sie eine Gruppe Schweine mit adulten Tieren und Jungtieren auf zwei Flächen von rund 1.2 Hektaren hielten. Das Verhalten wurde per Direktbeobachtung erfasst. Es wurden Scan-Sampling-Verfahren und kontinuierliche Fokustierbeobachtungen angewandt. Anfang der 80er Jahre hat die Forschungsgruppe mehrere Publikationen zu dem Versuch veröffentlicht und aus den Erkenntnissen auch Vorschläge für neue Haltungssysteme abgeleitet.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben gezeigt, dass Schweine in Bezug auf Quantität und Qualität der Verhaltensabläufe noch sehr ähnliche Muster zeigen wie Wildschweine. Verhalten scheint also genetisch fixiert zu sein und wurde über die Selektion auf Leistung nicht oder kaum beeinflusst. Bis heute orientiert sich die Tierwohl- und Verhaltensforschung im Bereich Schweine an diesen 40-jährigen Erkenntnissen. Insbesondere die Publikation von 1989 wurde bis heute 355-mal zitiert. Die Resultate aus diesen Erhebungen waren aber relativ grob und lassen viele Fragen offen. Die wichtigsten Verhaltensweisen wurden quantifiziert und nach Geschlecht und Altersgruppe aufgeschlüsselt. Grösstenteils blieb es aber bei einer qualitativen Beschreibung der Situation. Unklar ist auch, welchen Einfluss weitere 40 Jahre intensive Selektion auf Fruchtbarkeit und Mastleistung in Bezug auf das Verhalten hatten.
Die ethologischen, technischen und statistischen Methoden von heute lassen sich kaum mit jenen von damals vergleichen. Damit besteht mit der heutigen Methodik grosses Potenzial, um 1) die bereits beschriebenen Verhaltensweisen von Schweinen in einer semi-natürlichen Umgebung noch detaillierter und über längere Zeiträume zu erfassen und 2) die offenen Fragestellungen zu beantworten. Wissen über natürliche oder vom Menschen kaum beeinflusste Verhaltensabläufe sind die Basis für die Entwicklung von tiergerechten Haltungssystemen.
Eine Forschungsgruppe um Alex Stolba und David Wood-Gush wollte damals untersuchen, ob Sauen aus Kastenstandhaltung und mit der üblichen Genetik noch in der Lage sind, in einer semi-natürlichen Umgebung zu überleben. Dafür konzipierten sie 1978 einen Versuch in der Nähe von Edinburgh, wo sie eine Gruppe Schweine mit adulten Tieren und Jungtieren auf zwei Flächen von rund 1.2 Hektaren hielten. Das Verhalten wurde per Direktbeobachtung erfasst. Es wurden Scan-Sampling-Verfahren und kontinuierliche Fokustierbeobachtungen angewandt. Anfang der 80er Jahre hat die Forschungsgruppe mehrere Publikationen zu dem Versuch veröffentlicht und aus den Erkenntnissen auch Vorschläge für neue Haltungssysteme abgeleitet.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben gezeigt, dass Schweine in Bezug auf Quantität und Qualität der Verhaltensabläufe noch sehr ähnliche Muster zeigen wie Wildschweine. Verhalten scheint also genetisch fixiert zu sein und wurde über die Selektion auf Leistung nicht oder kaum beeinflusst. Bis heute orientiert sich die Tierwohl- und Verhaltensforschung im Bereich Schweine an diesen 40-jährigen Erkenntnissen. Insbesondere die Publikation von 1989 wurde bis heute 355-mal zitiert. Die Resultate aus diesen Erhebungen waren aber relativ grob und lassen viele Fragen offen. Die wichtigsten Verhaltensweisen wurden quantifiziert und nach Geschlecht und Altersgruppe aufgeschlüsselt. Grösstenteils blieb es aber bei einer qualitativen Beschreibung der Situation. Unklar ist auch, welchen Einfluss weitere 40 Jahre intensive Selektion auf Fruchtbarkeit und Mastleistung in Bezug auf das Verhalten hatten.
Die ethologischen, technischen und statistischen Methoden von heute lassen sich kaum mit jenen von damals vergleichen. Damit besteht mit der heutigen Methodik grosses Potenzial, um 1) die bereits beschriebenen Verhaltensweisen von Schweinen in einer semi-natürlichen Umgebung noch detaillierter und über längere Zeiträume zu erfassen und 2) die offenen Fragestellungen zu beantworten. Wissen über natürliche oder vom Menschen kaum beeinflusste Verhaltensabläufe sind die Basis für die Entwicklung von tiergerechten Haltungssystemen.